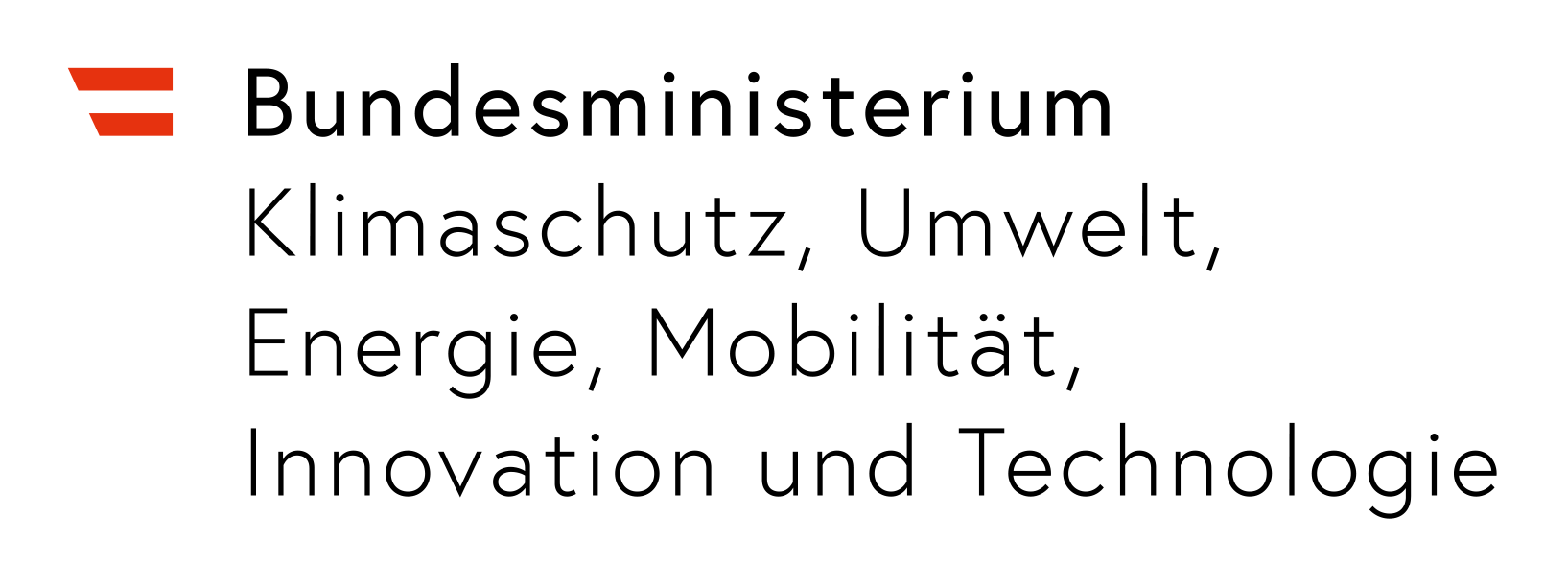Kategorie Innovation & Technologie - 23. Juli 2018
Wie die Medizin der Zukunft funktioniert
Die Digitalisierung bringt neue Einblicke in die Dynamik des Lebens und soll langfristig helfen, Krankheiten zu beseitigen.
Die Stimmung im Kreissaal war angespannt. Das Baby schien im Geburtskanal festzustecken, für einen kurzen Moment. Doch dann hörten alle erleichtert den ersten Schrei des Neugeborenen. Während die Ärztin das Kind abnabelt, wird von einer Assistentin bereits eine digitale Gesundheitsakte erstellt, eine Art Mutter-Kind-Pass, der jedoch eine lebenslange Angelegenheit sein wird. Willkommen in der digitalisierten Medizin. Wir wagen einen Blick in die Zukunft.
Ein paar Bluttropfen des Babys reichen aus, um sein Genom zu sequenzieren und es in die digitale Akte zu spielen. Künftige Untersuchungen, Erkrankungen und Impfungen werden alle dort eingetragen, stehen Ärzten, Patienten, Versicherungen und Forschern zu jeder Zeit zur Verfügung.
Alle Lebensjahre im Kalkül
Gene, das weiß man, schalten sich im Laufe eines Lebens an und aus. Wie und wann genau, darüber könnten diese Datenfiles Auskunft geben und insofern auch Krankheitsrisiken genauer definieren. Und wenn dieser neugeborene Mensch 50 Jahre später tatsächlich starke Bauchschmerzen bekäme, würde die Diagnose viel schneller gestellt, der Krebs viel genauer als bisher typisiert und behandelt werden.

Vier Nukleinbasen, die in drei Milliarden Paaren das Leben sind: Wie alles zusammenhängt, fördern Computer zutage. Daten sind heute der Treibstoff für medizinischen Fortschritt. Illustration © Francesco Cioccolella
„Daten werden ein medizinischer Rohstoff, aus dem wir maßgeschneiderte Handlungsanweisungen ableiten“, sagt Michael Krainer, Onkologe an der Universitätsklinik für Innere Medizin an der Med-Uni Wien. Ein Programm entscheidet, welche Therapie medizinisch Sinn macht.
„Die neue Medizin der Zukunft wird personalisiert sein, also individuell zugeschnitten auf unsere genetisch ererbten Eigenschaften, unsere genetischen Erfahrungswerte und unsere immunologische Geschichte“, fasst es der Molekularbiologe Giulio Superti-Furga vom Zentrum für Molekulare Medizin an der Med-Uni Wien zusammen.
Therapiert wird nicht mehr wie heute nach dem Gießkannenprinzip, sondern maßgeschneidert. Krebs könnte, rechtzeitig erkannt und behandelt, zunehmend eine vorübergehende Krankheitsepisode werden – und seinen todbringenden Nimbus verlieren.
Evolution steuern
Oder eines Tages vielleicht sogar vollständig zerstört werden. Denn Krebsspezialisten setzen große Hoffnungen gerade deshalb auf die Immunonkologie. In diesem therapeutischen Ansatz werden nämlich nicht die kranken Zellen selbst angegriffen, sondern die vom Krebs lahmgelegten Immunzellen reaktiviert. Der Kampf über die Bande findet auch heute schon statt.
Die Wissenschaftler haben parallel dazu auch gelernt, wie sich die DNA des Menschen mit eingeschleusten Viren manipulieren lässt. Mit der Genschere, dem CRISPR/Cas9-Verfahren, lassen sich kranke Teile des menschlichen Bauplans ersetzen. Mit dieser biochemischen Methode können Krankheiten möglicherweise sogar geheilt werden.
Das ist einstweilen aber nur eine Idee mit einem enormen Risiko: Die biomolekulare Manipulation hat das Potenzial, die gesamte Menschheit zu verändern. Dann nämlich, wenn solche Verfahren auf die Keimzellen der Menschen angewendet werden, etwa um Erbkrankheiten zu heilen. Damit könnten unter Umständen schwere genetische Erkrankungen bereits im Kindesalter tatsächlich ausradiert werden, doch wenn diese genmanipulierten Individuen eines Tages selbst Kinder bekommen, können wir „die Folgen derzeit überhaupt nicht abschätzen“, so Superti-Furga, und das sei der Grund, warum sich die Wissenschaftscommunity heute in diesem Bereich Selbstbeschränkungen auferlegt hat. Durch ein Mehr an Wissen könnte diese moralische Schranke eines Tages jedoch fallen.
Ersatzteile finden
Abgesehen davon werden sich Therapien für den Menschen im ausgehenden 21. Jahrhundert noch in einem ganz anderen Gebiet verändern. „Durch die Fortschritte in der Transplantationsmedizin eröffnen sich noch ungeahnte Möglichkeiten“, prognostiziert Patrick Schöggl, Direktor bei Deloitte Österreich und dort für Healthcare zuständig. Die Zukunft, so der Experte, habe bereits begonnen. Organe werden von Mensch zu Mensch verpflanzt, könnten aber schon bald auch im Labor gezüchtet werden.
Wenn es um die menschliche Hardware geht, also Knochen zum Beispiel, werden schon heute ganze Schädeldecken mit speziellen Programmen auf Basis von CT-Bildern konstruiert und in 3D-Druckern ausgedruckt – für Patienten nach Unfällen zum Beispiel. Auch an der Rekonstruktion von Blutgefäßen wie der zentralen Aorta arbeiten Forscher wie Utz Kappert am Herzzentrum in Dresden. „Als Operateur kann ich vor einem Eingriff sämtliche Schritte am Computer planen, simulieren, durchspielen und schon im Vorhinein Alternativen überlegen“, erläutert er die Vorteile. Die kühnste Vision sind wohl Organdrucker, die im Operationssaal ausdrucken, was gerade gebraucht wird.
Fit ohne Ende
Denn klar ist: Wenn die Menschen immer älter werden, wird auch der Bedarf an Ersatzteilen steigen. Bei jedem medizinischen Fortschritt wird der Erhalt der Lebensqualität von Patienten ein zunehmend wichtiges Kriterium sein. Laut EU-Aging-Report werden 13 Prozent der Europäerinnen im Jahr 2070 älter als 80 Jahre sein. Zum Vergleich: Heute sind es nur fünf Prozent. „Im Alter länger gesund bleiben, weil die Menschen Gesundheitsvorsorge betreiben“, nennt Manfred Anderle, Obmann der österreichischen Pensionsversicherungsanstalt, eines der vorrangigen Ziele. Aus seiner Sicht bedeutet das, das Pflegegeld erst so spät wie möglich bewilligen zu müssen.
Für dieses Ziel werden in der PVA die Maßnahmen zur „Gesundheitsvorsorge aktiv“ auch für Pensionisten forciert. Denn Menschen sollen so lange wie möglich selbstständig leben können. Auch dabei wird die elektronische Akte wichtig sein. Möglicherweise findet eines Tages sogar eine automatische Fernwartung des Menschen statt. Intern und extern. Klar ist, dass im Zeitalter der Digitalisierung Berufsgruppen enger zusammenarbeiten müssen.
Werkzeuge gegen Demenz
Wie das geht, erleben Neurologen, IT-Experten und Designer gerade im Rahmen des EU-Projektes Memento, das Menschen mit Demenz das Wohnen zu Hause länger als bisher ermöglichen wird. Die zentrale Frage ist, welche digitalen Tools die schwindende Gedächtnisleistung im Alltag kompensieren können beziehungsweise Hilfestellungen in Notsituationen sein könnten. Eine GPS-Uhr zum Beispiel könnte einspringen, wenn Demenzkranke ihre Orientierung verloren haben und umherirren. Sensoren zu Hause könnten gewährleisten, dass der Herd immer abgeschaltet ist.
„Mediziner verstehen nicht, wie Informatiker denken, und Informatiker haben keine Ahnung, was Demenz ist“, sagt Neurologin Elisabeth Stögmann, die im Rahmen der Memento-Workshops erlebt, was technisch machbar ist. Die unterschiedlichen Denkweisen empfindet sie als Herausforderung, davon sollen zukünftige Patienten profitieren. Was Demenz verursacht, ist bis heute unklar. Klar ist lediglich, dass die Lebensbedingungen eine Rolle spielen. Prävention, also die Vermeidung von Krankheiten, hat deshalb in nahezu allen Bereichen Priorität. Wer weiß, dass er ein erhöhtes Schlaganfallrisiko hat, könnte weniger Fleisch essen oder regelmäßig Sport treiben.
Einflüsse von außen
„Wir entdecken gerade erst den Einfluss, den die Umwelt auf die DNA des Menschen hat“, betont Superti-Furga und sieht Chancen, dass die Vorzeichen von Erkrankungen früher erkannt und damit besser behandelt werden können. Eines Tages könnte es sein, dass winzige Nanoroboter im Organismus patrouillieren, um Risiken zu orten. Klingt alles nach Science-Fiction? Die Marktforscher von Frost & Sullivan haben kürzlich eine Studie präsentiert, in der sie dem Geschäftsfeld der digitalen Pathologie in Verbindung mit künstlich intelligenten Systemen hohe Wachstumsraten prognostizieren. Bis 2021 wird der Markt um 13,2 Prozent wachsen.
Karin Pollack, DerStandard