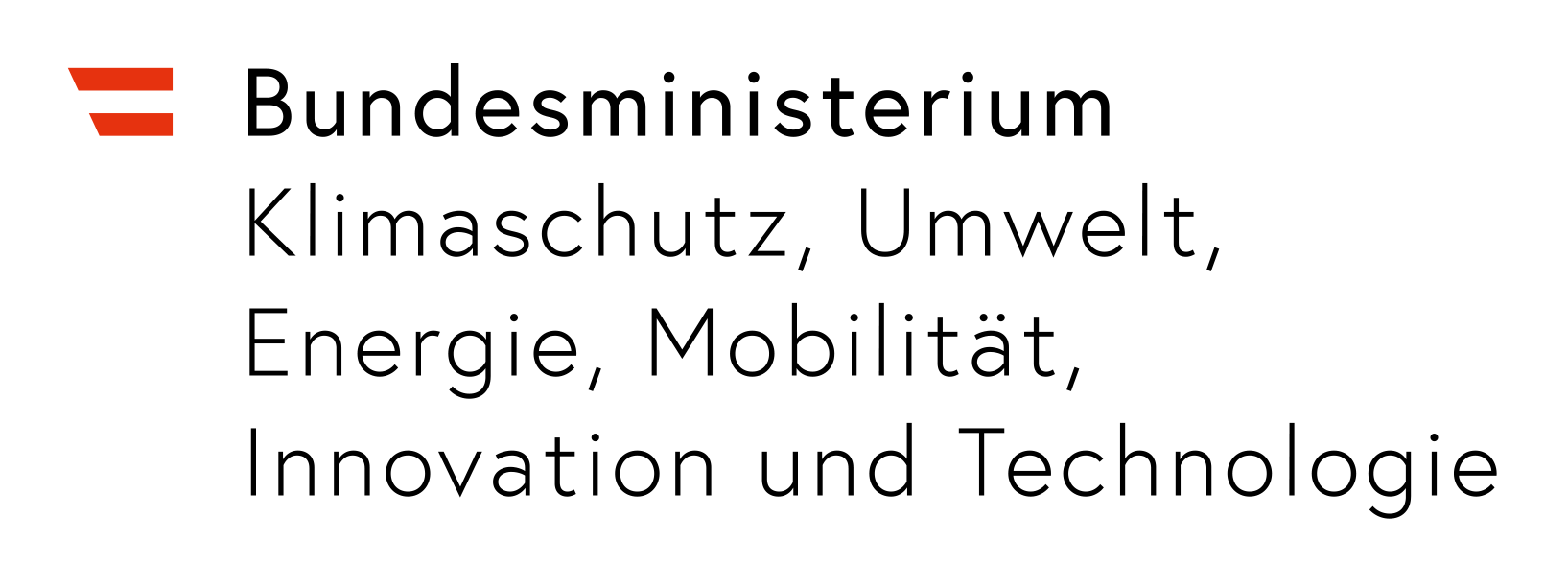Kategorie Innovation & Technologie - 26. März 2017
K.-o.-Tropfen sollen besser nachweisbar werden
Na, die wird halt betrunken gewesen sein . . .“ Solche Nachrede belastet Menschen zusätzlich, denen durch K.-o.-Tropfen ohnehin schon Schaden zugefügt wurde. Bisher ist eine gängige Substanz, die zu komatösem Schlaf führen kann, nicht gut nachweisbar: Gammahydroxybuttersäure, kurz GHB. In leichter Dosierung wird es als Partydroge, Liquid Extasy, eingenommen, weil es schnell zum Rauscheffekt führt.
Höher dosiert entstehen daraus K.-o.-Tropfen, die bei Sexualdelikten oder Raubüberfällen eingesetzt werden und die meist von Gedächtnislücken begleitet sind. „Generell gilt GHB als schwer nachweisbar, da unser Körper selbst GHB produziert und extern zugeführtes GHB schnell abgebaut wird“, sagt Bernd Bodiselitsch, Geschäftsführer von Imprint Analytics. Sein Team entwickelte mit dem Klinischen Institut für Labormedizin der Med-Uni Wien – gefördert im Kiras-Sicherheitsprogramm des Technologieministeriums – eine Methode, wie man das körpereigene GHB von extern zugeführtem unterscheiden und so den Opfern ihre Glaubwürdigkeit zurückgeben kann.
Ohne Blutabnahme
Die Methode selbst, die Isotopenanalyse, ist nicht neu. Beinahe jedes chemische Element kommt in unterschiedlich schweren Varianten vor: Je nach Herkunftsregion hat jede Substanz einen Isotopenfingerabdruck, der kaum verfälscht werden kann. Isotopenanalyse deckt etwa auf, wenn „echt steirisches Kernöl“ in China produziert wurde oder ungarischer Paprika von woanders herkommt. Auch beim Nachweis von Doping hilft Isotopenanalyse, das körpereigene Testosteron von künstlich zugeführtem zu unterscheiden.
Genau nach dem Prinzip erstellte das burgenländische Team nun einen Ansatz, um eine GHB-Einnahme nachweisen zu können. Bisher wurde den Patienten Blut abgenommen und untersucht, ob der GHB-Wert über dem Durchschnitt liegt. Der Nachweis, woher die Substanz stammt, bleibt dabei aus. „Wir wollten extern zugeführtes GHB in einer Körperflüssigkeit finden, die jeder selbst abnehmen kann, man daher weder zur Polizei noch zum Arzt gehen muss. Also im Urin“, erklärt Bodiselitsch.
Der Vorteil von Harn ist, dass er leicht handzuhaben ist. Der Nachteil: „Das ist eine verschmutzte, dreckige Matrix, in der man die gesuchte Substanz kompliziert isolieren und reinigen muss.“ Diese Herausforderung gelang – und das, ohne den Isotopenfingerabdruck von GHB zu verfälschen. Die hochsensible Analytik, bei der das Isotopenmuster von Wasserstoff und Kohlenstoff der GHB-Moleküle bestimmt wurde, zeigte einen klaren Unterschied zwischen dem vom Körper produzierten und extern zugeführtem GHB.
Mehr Realproben notwendig
„Wir hatten aber nicht viele Realproben zur Verfügung, um die Methode zu verfeinern“, erzählt Bodiselitsch. Um die Methode zu optimieren, wäre weitere Forschungsarbeit notwendig, für die das Start-up nach einem Industriepartner sucht. „Wir wollen auch das Isotopenmuster der Sauerstoffatome im GHB überprüfen, um die Sicherheit der Methode zu erhöhen“, so Bodiselitsch. Denn hundertprozentig war das Ergebnis bisher nicht, vor Gericht könnte die Methode nicht zur Beweisführung verwendet werden.
„Uns wäre wichtig, dass den Betroffenen geholfen wird.“ Wenn einem nach einer Partynacht etwas zustößt, ein Sexualdelikt etwa, wird dem Opfer oft nicht geglaubt: Solange es keinen Beweis gibt, kann man nicht einmal vor Familie und Freunden klarstellen, was passiert ist. „Unser Ziel wäre, dass Betroffene uns innerhalb von 24 Stunden nach dem Vorfall eine Urinprobe senden und wir nachweisen können, ob GHB extern zugeführt wurde“, sagt Bodiselitsch.
Sein Team konzentrierte sich in dem Projekt namens IsoCSI auch auf Faserspuren, die die Polizei bei Kriminalfällen sichert. Winzige Fasern aus der Kleidung geben oft Hinweise, welche Personen am Tatort waren. „In 90 Prozent der Fälle kann herkömmliche Mikroskopie beantworten, ob die gefundenen Fasern zur Kleidung der verdächtigen Person passen. Aber bei Stoffen wie Bluejeans oder ungefärbter Baumwolle funktioniert Mikroskopie nicht.“
Faserspuren identifizieren
Daher lag die Hoffnung auch auf der Isotopenanalyse, die den Herkunftsort von Jeans oder eines T-Shirts belegen könnte. „Zur Beweissicherung werden allerdings spezielle Klebebänder benutzt, deren Material zu stark an den Fasern haftet. Wir konnten diese nicht vollständig entfernen, der Isotopenwert war durch die Spurensicherung zu stark verändert“, sagt Bodiselitsch. Daher waren diese Ergebnisse für die Kriminalistik nicht brauchbar. „Umsonst war unsere Arbeit aber nicht: Es wurde eine weltweite Isotopendatenbank von Baumwolle erstellt, die nun zur Identifikation der Herkunft von Baumwolle verwendet werden kann.“ (Von Veronika Schmidt, Die Presse)