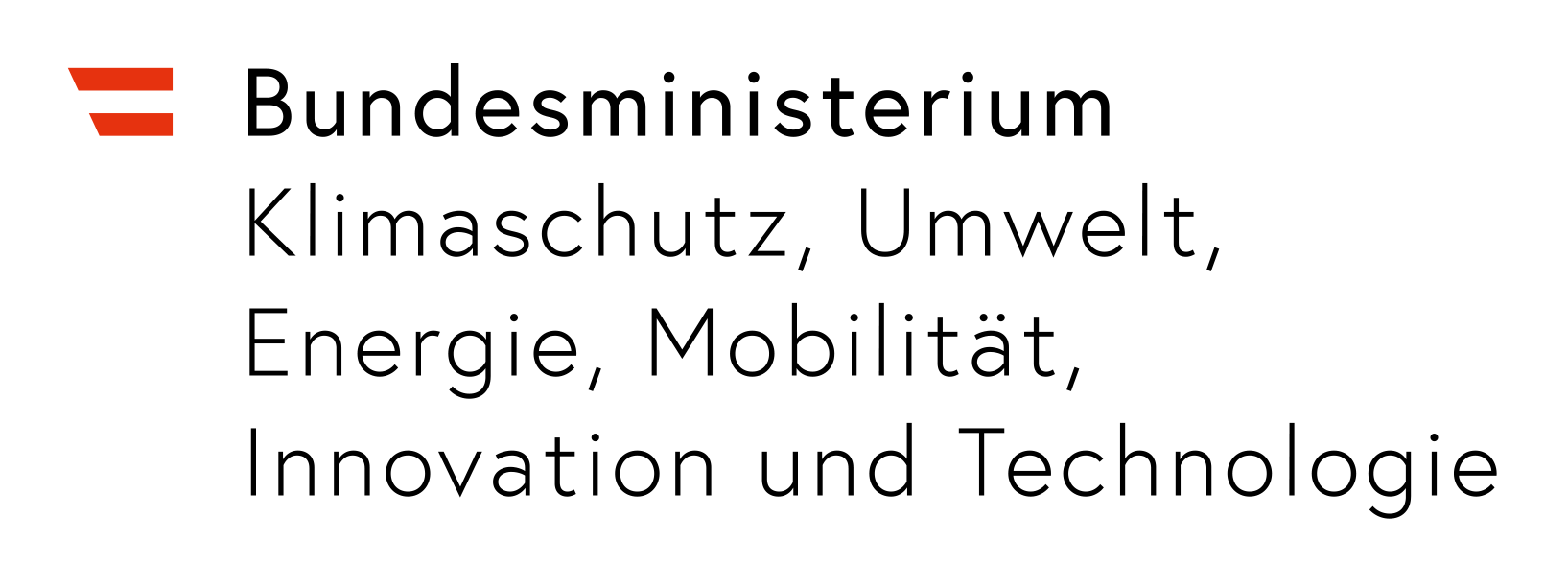Kategorie Innovation & Technologie - 19. Januar 2016
Open Innovation-Strategie nimmt Fahrt auf
350 Teilnehmer aus Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft und der Zivilgesellschaft trafen sich gestern, Montag, zum „Stakeholder“-Workshop zur Erarbeitung einer nationalen Open Innovation-Strategie in Wien. Gefragt waren Visionen für Open Innovation (OI)-Szenarien im Jahr 2030, die Identifizierung von Barrieren und Vorschläge zur Umsetzung von erforderlichen Maßnahmen.
Mit viel Engagement waren die Workshop-Besucher bei der Sache – im Nu strotzten die Pinnwände vor eng aneinander gedrängten, vollgeschriebenen Kärtchen. „Es ist toll, eingebunden zu werden und sich am Diskurs beteiligen zu können“, meinte denn auch Ruth Mateus-Berr, Professorin und Senatsvorsitzende an der Universität für angewandte Kunst – wobei sie natürlich hoffe, dass es sich um keine „Scheinpartizipation“ handle und Vorschläge auch berücksichtigt würden. Während Open Access und Open Data im Wissenschaftsbereich zumindest teilweise schon angekommen sei, sei dies in Unternehmen noch nicht der Fall, merkte Organisatorin Gertraud Leimüller von der Innovationsagentur winnovation an: „Hier braucht es künftig viel mehr Datenzugang“.
Visionen für die Zukunft
In der ersten Breakout-Session wurden insgesamt neun Szenarien für die Zukunft entwickelt. Wie könnte Open Innovation in Wirtschaft, Wissenschaft, der Gesellschaft in fünfzehn Jahren funktionieren? Wie könnte das Wissen, das Innovatoren benötigen, am besten – nicht zwangsläufig gratis – zugänglich sein? Wie schafft Österreich bis dahin den Wandel zum offenen Innovationsland, das für seine starke Experimentierfreude bekannt ist? Unter den Antworten fand sich die Schaffung einer offenen Webplattform, eines österreichweiten Intranet. Wer aber sollte entscheiden dürfen, was Innovation ist? Auf jeden Fall keine „Altherrenrunden“, hieß es. Auch Forschungsförderung, die ausschließlich in „Trendblasen“ stattfände, wurde als Barriere for Open Innovation identifiziert – ebenso Parteipolitik und Pfründe-Denken. Mangelnde Datensicherheit und rechtliche Hindernisse bezüglich der Verwertung von Innovationen wurden als weitere Hemmschuhe genannt.
Zudem sollten die Schnittstellen zwischen den Institutionen – von Kindergärten zu Schulen, von Unis zur Gesellschaft – stärker verzahnt werden. Soziale Innovationen sollten bis 2030 selbstverständlich sein, auch die direkte Beteiligung von sozial Benachteiligten wurde als Vision gewählt. Als Herausforderung nannten die Teilnehmer die Entwicklung niederschwelliger Beteiligungsformen für alle Akteure jenseits der „üblichen Verdächtigen“. Ein wünschenswertes Grundprinzip war häufig die Forderung nach „Vertrauen“: Persönlichkeit und Talente vom Kleinkindalter an stärken, aber auch sich trauen, Mitbewerber ins Boot zu holen.
Laut war der Ruf nach mehr Fehlertoleranz, gekoppelt an eine „Erfolgstoleranz“: sprich, sich über Erfolge anderer neidlos freuen zu können. Als Wunsch fiel auch jener nach einer „neuen Schule“, in denen „spinnen“ erlaubt sei, und welche die zahlreichen „Camps“ und außerschulischen Angebote im besten Fall überflüssig mache und die Lust an der Kreativität fördere.
Maßnahmen für die Umsetzung
Ob das Open Innovation-Prinzip bei angewandter Forschung das richtige sei, diskutierten einige Workshop-Teilnehmer im Rahmen der zweiten Breakout-Session, in welcher es um neun konkrete Maßnahmen für die Umsetzung ging. „Der Trend in Unternehmen geht komplett in die Gegenrichtung“, meinte denn auch ein langjähriger Industrie-Experte. „Wenn ein Projektleiter mit jemandem außerhalb seines Teams über sein Projekt spricht, kann er sich die Kündigung gleich selber schreiben“, betonte er. Auch die IP-Strategie des Bundes, an der gearbeitet werde, stelle hier einen großen Gegensatz dar. Open Innovation stehe übrigens innerhalb eines Unternehmens ebenso oft vor unüberbrückbaren Hürden, hieß es. Hier könnte eine Auslagerung, etwa in „Pop-up Labs“ oder „Knowledge Hubs“, Abhilfe schaffen.
Als hilfreich erachteten die Workshop-Teilnehmer den Aufbau eines Expertennetzwerks. Ehe aber „noch eine“ Plattform geschaffen werde, solle man versuchen, bereits bestehende auszubauen, so der Tenor. Auch sei ein niederschwelliger Zugang und echte Teilhabemöglichkeit unter Wahrung des Datenschutzes vonnöten. Angedacht wurden weiters Maßnahmen für die Einrichtung einer Plattform für gesellschaftliche Herausforderungen. Die Macht, die von einer rege genutzten zivilgesellschaftlichen Plattform ausginge, sei nicht zu unterschätzen.
Wozu das ganze? Konkrete Ziele gefragt
Welchen Zweck verfolgt eigentlich Open Innovation? „Geht es um den Wettbewerbsvorteil oder um mehr – um die Lösung von Herausforderungen wie dem Klimawandel oder der Migration? Geht es bei IPR (Intellectual Property Rights) um die Abschottung von Wissen? Oder wird der Kuchen doch nicht kleiner, wenn man ihn teilt?“, diese Fragen stellte Leimüller in den Raum und erinnerte daran, Klein- und Mittelbetriebe nicht zu vergessen: „Hier fehlt oft die Erfahrung mit dem Thema“.
Wie wichtig im Zusammenhang mit Open Innovation konkrete Fragestellungen sind, betonte Lucia Malfent von der Ludwig Boltzmann Gesellschaft, die ein OI-Projekt zur Erarbeitung von Forschungsfragen zu psychischen Erkrankungen leitet. „Ich bin für eine klare Sprache und genaue Zielsetzungen. Die Menschen wollen wissen, was mit ihrem Beitrag passiert – sonst ebbt die Begeisterung, mitzuarbeiten, rasch ab.“
Den gleichen Punkt sprach auch Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb an. „Was mir bei der Veranstaltung abgeht, ist die Frage, wofür Innovationen? Innovation soll man nicht um der Innovation willen fördern, sondern in Richtung der Grand Challenges, die weltweit zur Lösung anstehen“, gab sie zu bedenken. Noch sei das universitäre System „alles andere als ‚open‘, und auch nicht ‚Open Innovation‘. „Das fängt dabei an, wen man überhaupt an die Universitäten lässt und wie man mit Quereinsteigern umgeht. Auch bezüglich der dominierenden Wissenschaftsverlage, die darüber entscheiden, was publiziert wird, gäbe es sehr viel zu tun.“ Eine weitere Herausforderung sei das Pariser Klimaabkommen: „Wenn wir bis 2050 die CO2-Emissionen in Österreich auf Null reduzieren müssen, brauchen wir alle Köpfe dazu.“
„Sehr spannend“ fand Patrick Lehner, Direktor Administration Institute bei der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), das Thema und die kontextual breit aufgestellte Diskussion im Workshop. Sie zeige aber auch, dass wir bereits in einem Umbruch lebten. „Die Jungen leben uns Open Innovation vor: Instagram, Facebook, Open Access-Journals, Start-ups – ein junger Programmierer stellt sein Script online und freut sich, wenn das von einem anderen weiterentwickelt wird. Worüber wir da reden, das ist für die Jugend Schnee von gestern“, zeigte er sich überzeugt.
Konsultationsprozess startet im Februar
Keine im Workshop erarbeitete Idee gehe verloren, betonte Andreas Reichhardt, Sektionschef für Innovation und Telekommunikation im Technologieministerium (bmvit). „Wir werden so viele Beiträge wie möglich berücksichtigen.“ Im Februar beginnt dann der sogenannte „Konsultationsprozess“, im Zuge dessen die Bevölkerung über die Website www.openinnovation.gv.at den Entwurf der Strategie mit den vier Themenfeldern „Wissenschaft und Forschung“, „Wirtschaft“, „Soziale Innovation“ und „Verwaltung“ diskutieren kann. Bis zum Sommer soll der Entwurf dem Parlament vorgelegt werden, so der Plan. Dann erst geht es an die eigentliche Arbeit: die Umsetzung.
Service: Link zur Fotogalerie: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/7451/ ; weitere Infos und Hintergründe zur Open Innovation-Strategie finden Sie unter http://science.apa.at/koop/openinnovation
(Von Sylvia Maier-Kubala/APA-Science)