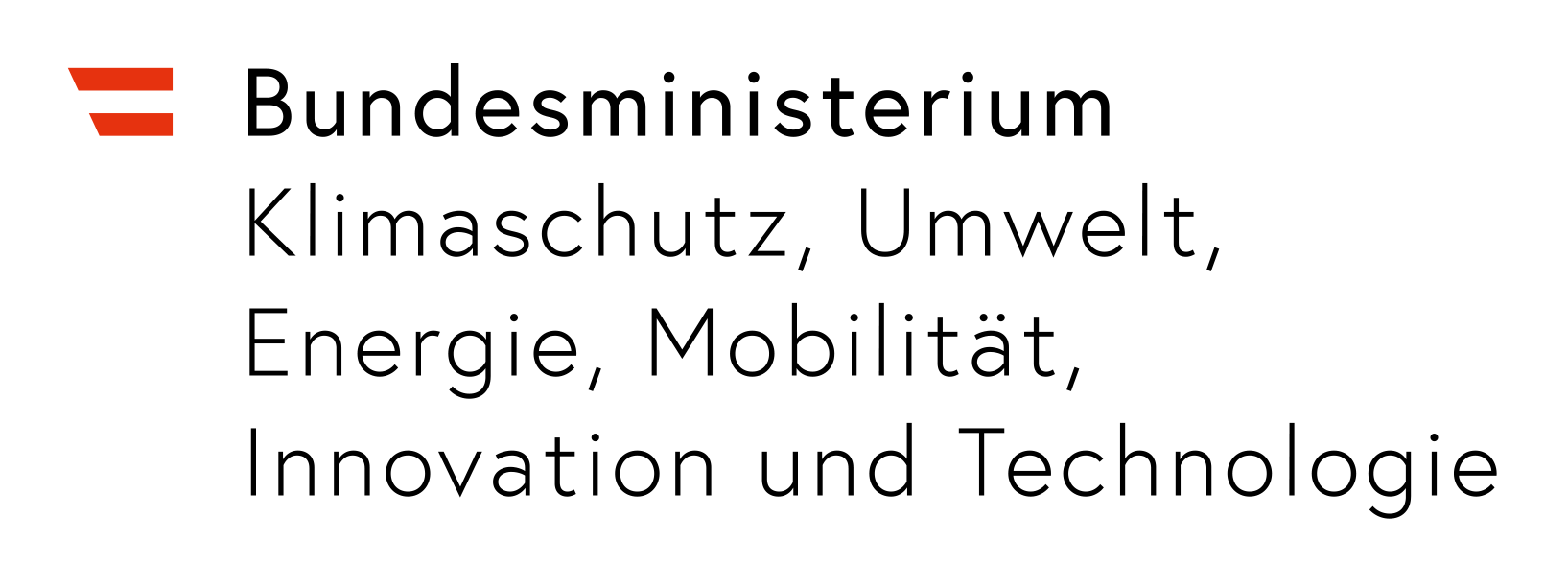Kategorie Innovation & Technologie - 5. Mai 2017
Wie die Donau wieder wilder wird
Während der Arbeit stießen die Wissenschaftler auf Verblüffendes. Erstmals wiesen sie im Donauabschnitt bei Bad Deutsch-Altenburg eine Art Wanderdünen aus Kies nach. Sie sind bis zu 20 Meter lang, 40 Zentimeter hoch und bewegen sich mit sechs Metern pro Stunde über den Grund der Donau. Fast wie Sanddünen in der Sahara. „Das hat uns wirklich überrascht“, sagt Helmut Habersack. Er leitet ein rund 20-köpfiges Forschungsteam im Rahmen des im Juli 2010 an der BOKU Wien eröffneten Christian-Doppler-Labors (CD-Labor) „Innovative Methoden in Fließgewässermonitoring, Modellierung und Flussbau“. Nach siebenjähriger Forschungsarbeit läuft das Projekt nun Ende April aus. Ziel war unter anderem, die Donau punktuell in ihre wilde Vergangenheit zurückzuführen.
Chaos als Lebensprinzip
Früher trat sie mit ihren ständig den Verlauf ändernden Armen über die Ufer, wann und wo es ihr beliebte. Sie riss oft alles nieder, was im Weg lag. Kies- und Schotterbänke, Wiesen, Sträucher, Bäume. Chaos war ihr Lebensprinzip. Genau darauf hatte sich die Natur in Jahrmillionen eingestellt. Viele Pflanzen und Tiere brauchen eben jene durch Erosion oder Ablagerungen geschaffenen offenen Flächen. Für den Menschen war das auf Dauer zu unkalkulierbar. Er machte den Strom hochwassersicher und schifffahrtstauglich. Wasserkraftwerke entstanden; die Natur wurde in Nationalparks und Auenlandschaften zurückgedrängt.
Aber ließen sich ökonomische und ökologische Ziele nicht gemeinsam erreichen? Um es herauszufinden, sahen sich die Forscher unter anderem die Buhnen an, also jene Steindämme, die vom Ufer aus in den Fluss ragen. „Buhnen wurden gebaut, damit der Fluss nicht seitlich ausbricht und die Schifffahrtsrinne ausreichend tief bleibt“, erklärt Wasserbau-Ingenieur Habersack. Die Einschnürung der Flussrinne und die dadurch erhöhte Fließgeschwindigkeit tragen aber auch dazu bei, dass sich die Donau immer tiefer eingräbt.
Auf Teilabschnitten einer drei Kilometer langen Versuchsstrecke bei Bad Deutsch-Altenburg wurde nun anderes probiert: Statt im 90-Grad-Winkel neigen sich die Buhnen leicht flussabwärts. Der Abstand zwischen den einzelnen Buhnen ist größer. Zudem haben Bagger dort, wo die Buhnen üblicherweise mit dem Ufer verbunden sind, Steine entnommen. „Das ist eine kleine Öffnung, wo das Wasser durchströmen kann“, beschreibt Habersack. „So entsteht ein Fluss entlang des Ufers, der strömungsabhängigen Fischen Lebensraum bietet.“ Gleichzeitig initiiert der „Fluss im Fluss“ die Erosion des Ufers. Die Donau darf wieder ein bisschen wild sein. „Das schafft Brutmöglichkeiten für Eisvogel und Uferschwalbe. Hier und da bilden sich kleine Schotterbänke, wo etwa der Flussregenpfeiffer seine Eier ablegt“, so Habersack. Die Forscher haben festgestellt, dass sich der Strom bei bestimmten Buhnen-Varianten nicht weiter eingräbt. Stellenweise kam es gar zu einer Erhöhung der Flusssohle.
Die Forscher beschäftigten sich auch mit dem Geschiebe, also mit Schotter und Kies, die der Fluss auf dem Grund vor sich herschiebt. Früher kam das Material durch natürliche Erosion aus den Alpen. Heute wird es von Kraftwerken und anderen Verbauungen aufgehalten, weshalb etwa der Betreiber des Kraftwerks Freudenau jährlich rund 200.000 Kubikmeter Schotter in den Fluss schüttet. „Dadurch reduziert sich die Erosionsrate der Donau von 3,5 auf zwei Zentimeter pro Jahr“, so Projektleiter Habersack.
Versuchsfelder am Donaugrund
Die Forscher wollten wissen, wie das Material beschaffen sein muss, damit es seinen Zweck optimal erfüllt. Vom Schiff aus wurden am Donaugrund unterschiedliche Versuchsfelder angelegt. Kern war eine 25 Zentimeter starke Schicht aus vier bis sieben Zentimeter großen Steinen. Auf einigen Feldern war das Material gröber oder feiner, mal wurde es per Baggerschaufel angedrückt, mal nicht. In definierten Zeitabständen schlugen die Forscher Lanzen ins Flussbett und füllten sie mit flüssigem Stickstoff, der das umliegende Material anfrieren ließ. „Wir haben Scheiben abgeschnitten und konnten genau sehen, wo das gröbere Material noch vorhanden ist oder ob es bereits wegerodiert wurde.“ Wichtige Erkenntnisse lieferten mit einem Sender versehene, verfolgbare Kunststeine. „So wie andere Forscher Bären verfolgen, schauen wir ob die Steine länger liegen bleiben oder nicht“, erzählt Habersack. „Wir haben festgestellt, dass manche Steingrößen beweglicher sind, als sie es theoretisch sein sollten.“ Ein Durchschnittsstein bringt es auf rund drei Kilometer im Jahr.
Die Erkenntnisse aus dem Projekt wird die Viadonau, also die Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft, in künftige Maßnahmen einfließen lassen. Sie trug auch 50 Prozent der Kosten.
Resultate der Forschungsarbeit sind auch neue Messgeräte oder Formeln zur Beschreibung von Strömungsverhältnissen. Lässt etwa ein Kraftwerk aufgestautes Wasser ab, um eine Turbine anzutreiben, kann sich der Wasserdurchfluss schlagartig von einem auf 70 Kubikmeter pro Sekunde erhöhen. Der folgende Wasserschwall kann Fischlarven auf Schotterbänke spülen und verenden lassen. Hier nutzt das erweiterte Wissen ebenso wie beim Betrieb von Strom-Bojen, also schwimmenden Unterwasser-„Windrädern“, die ohne große Eingriffe in die Donau Energie liefern. (Von Timo Küntzle, Die Presse)